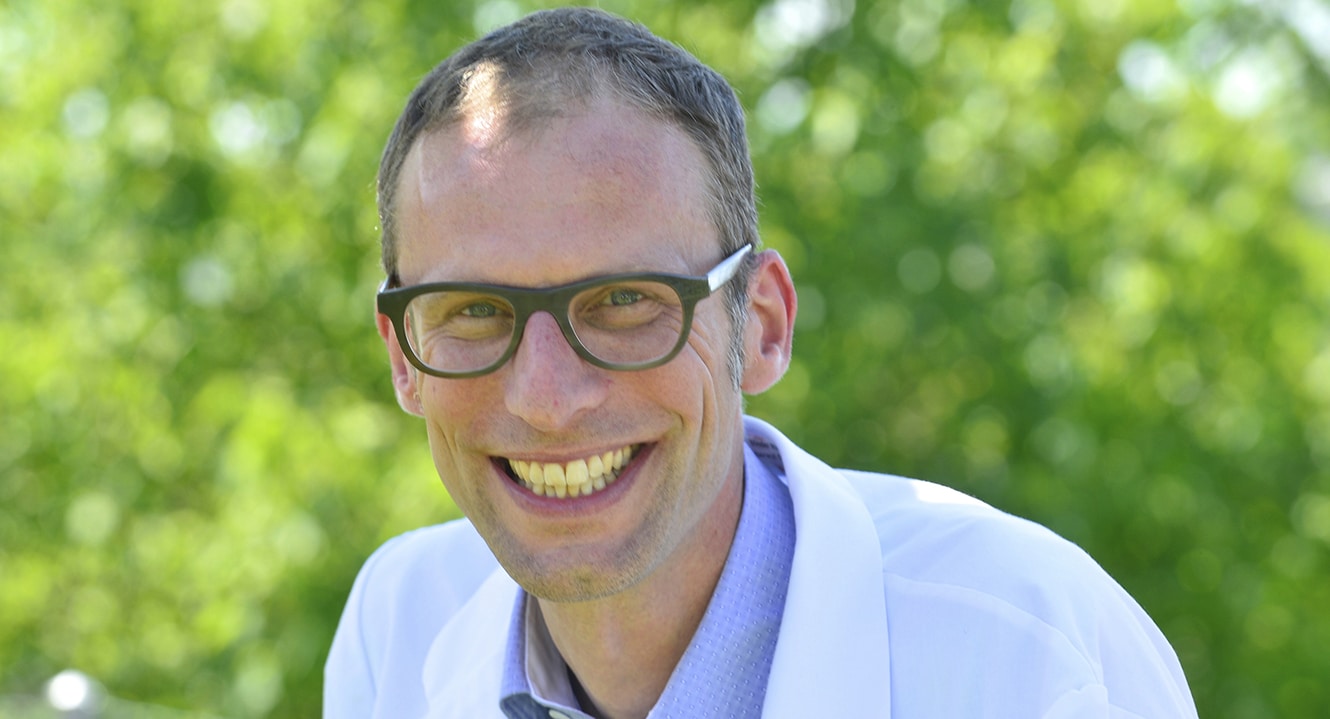Frau Bergsträsser: Sie arbeiten als Leitende Ärztin am Kinderspital Zürich, leiten das Kompetenzzentrum Palliative Care. Bitte erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit.
PD Dr. Eva Bergsträsser: Wichtig ist mir Folgendes: Wir betreuen nicht nur terminal erkrankte Kinder und Jugendliche in den letzten Tagen, Stunden. Unsere Arbeit beginnt schon viel früher. Manchmal gleich nach der Geburt. Und sie kann einige Jahre dauern.
Ein deutlicher Unterschied zur Betreuung bei Erwachsenen.
Genau. Palliative Care bei Erwachsenen ist viel mehr aufs Lebensende konzentriert. Wir betreuen Kinder durch alle Altersgruppen, vom Neugeborenen bis zur Achtzehnjährigen, manchmal sogar darüber hinaus. Gelegentlich – und da hoffe ich, es wird mehr in Zukunft – betreuen wir Kinder vor der Geburt und natürlich ebenso ihre Eltern.
Weil man weiss, dass das Kind Betreuungsbedarf haben wird, sobald es auf der Welt ist?
Ja. Weil das Kind eine nicht mit dem Leben vereinbare Erkrankung hat, die man genetisch oder bildgebend festgestellt hat, und die Eltern gefragt werden, was wünschen Sie sich? Sollen wir alles tun, oder soll man, wenn der Rucksack schon so schwer ist, den Schwerpunkt auf Komfort setzen und dem Kind eine Chance geben, es aber nicht zwingen, am Leben zu bleiben.

Die Betreuung der Kinder individuell gestalten
Dabei spielt die Betreuung von Eltern, Angehörigen, Geschwistern eine zentrale Rolle.
Das ist in der Palliative Care bei Kindern prinzipiell so. Wir fokussieren uns stark auf die Familie, auf das Umfeld. Wir betreuen einen hohen Anteil von Kindern, die neurologisch schwerst erkrankt sind und verbal nicht in der Lage sind, zu kommunizieren. Sie können uns also nicht mit der gesprochenen Sprache vermitteln, was ihnen fehlt. Deshalb läuft die Kommunikation häufig über die Eltern, manchmal über die Geschwister.
Und diese Betreuung geschieht nicht nur im Kinderspital?
Nein, nein. Sie findet in der Regel dort statt, wo es dem Kind am wohlsten ist und es am besten aufgehoben ist. Das kann im Spital sein – und das ist es auch sehr häufig. Das kann ebenso zu Hause sein oder in Langzeit-Institutionen, in anderen Kliniken.
Kontaktiert werden Sie dann von wem?
In der Regel sind es Fachpersonen, Spezialisten, die sich bei uns melden, seltener Haus- oder Kinderärzte. Manchmal vermittelt die Kinderspitex, oder Eltern rufen uns direkt an, weil sie von unserer Arbeit gehört haben.
Und so werden Sie, werden Leute aus Ihrem Team zu Haupt-Ansprechpersonen?
Haupt-Ansprechperson eher nicht. Denn diese Kinder leiden an Krankheiten, die durchaus noch behandlungsbedürftig sind und wo es in der Regel noch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Haben wir etwa ein schwer herzkrankes Kind, dann ist der Lead bei den Kardiologen und Herzchirurgen – wir sind beratend und unterstützend im Hintergrund.

Da sein, wenn Kind und Familie einen brauchen
Und Sie und Ihr Team begleiten die Familie?
So ist es. Wir sind wie eine Art Decke. Manchmal braucht es sie, manchmal kann man sie weglegen. Wir sind koordinativ tätig, begleitend.
Für diese Arbeit setzen Sie, setzt Ihr Team viel Herzblut ein. Das schafft Vertrauen und senkt die Hürde, in unmöglichen Zeiten anzurufen und Hilfe zu erbitten.
Das ist so, und es ist unser Ziel. Wir möchten frühzeitig informiert werden, damit wir eine Beziehung und Vertrauen zum Kind aufbauen können, zu den Eltern, zu Geschwistern.
Und die Familien, die trauen sich dann, zu «Unzeiten» anzurufen?
Das dürfen, und das sollen sie. In der Nacht und am Wochenende. Betroffene wissen, dass das Kispi-Telefon bei uns oft mit dabei ist zu Hause.
Endet die Beziehung, wenn ein Kind gestorben ist?
In der Regel schon. Nach dem Tod des Patienten, der Patientin endet mein ärztlicher Auftrag. Das ist formal so. Wir haben psychologisch ausgebildete Fachpersonen im Team und bieten Nachbetreuung an, begleiten Trauernde. Da gibt es die verschiedensten Angebote.
Sie bauen Beziehungen auf. Die können mehr oder weniger intensiv sein …
Das ist so. Und die kann ich nicht einfach kappen. In gewissen Fällen war ich den Menschen, den Familien sehr nah, bin oft ein- und ausgegangen. Dann gilt es, einen menschlichen sowie einen professionellen Ausklang zu finden. Einen Ausklang, der den Bedürfnissen gerecht wird und ebenso meinen Ressourcen, die sind nicht unbegrenzt vorhanden.

Spenden ermöglichen die Arbeit mit Herzblut
Sie müssen sich abgrenzen können.
Genau. In der Regel gelingt das gut. Die Leute wissen, wie sehr ich beschäftigt bin.
Wie wird Ihre Tätigkeit mit so viel Herzblut finanziert?
Nun, es geht nicht nur um die Finanzierung unseres Herzblutes, sondern um beispielsweise die hohen Personalkosten. Davon werden fünfzig Prozent durch Spenden gedeckt.
Ihre zeitaufwändige Arbeit kann niemals kostendeckend sein.
Richtig. Wir sind darauf angewiesen, dass etwa Sekretariatsprozente, Ärzteprozenten, Psychologen- sowie Sozialarbeitsprozente und so weiter durch Zuwendungen finanziert werden.
Dazu kommt, viele Ihrer Angebote für die Eltern, für die Angehörigen, können Sie gar nicht weiter verrechnen.
Das ist so. Es gibt Angebote für Geschwister, für Angehörige, für die Familien, die wir nicht abrechnen können. Da zahlt keine Krankenkasse und keine Versicherung.
Frau Dr. Bergsträsser, Sie führen laufend Gespräche mit Menschen über Leben und Sterben. Wie sehr beeinflusst diese Arbeit Ihr Leben?
Das ist nicht nur schwer, das ist auch schön. Wenn so eine Begleitung erfolgreich ist, wenn der Übergang vom Kämpfen um Therapie und Heilung in ein Akzeptieren von schwerer Krankheit und einem verkürzten Leben gelingt, kann das beglückend sein.
Beglückend trotz tragischem Schicksal?
Ja, wenn es uns gelingt, dass die Lebensqualität steigt innerhalb der Palliative Care. Es ist gut, zu sehen, wenn eine Familie nicht von Arzt zu Arzt rennt, sondern die verbleibende Lebenszeit nutzt, etwas für das kranke Kind und die Familie zu machen. Etwas, das später hilft, den Verlust zu verarbeiten. Aber klar, es gibt ebenso schwere Momente. Etwa, wenn die Begleitung Wochen dauerte, wenn sie Tag und Nacht stattfand, rund um die Uhr. Das erschöpft einen sowohl körperlich wie auch emotional.
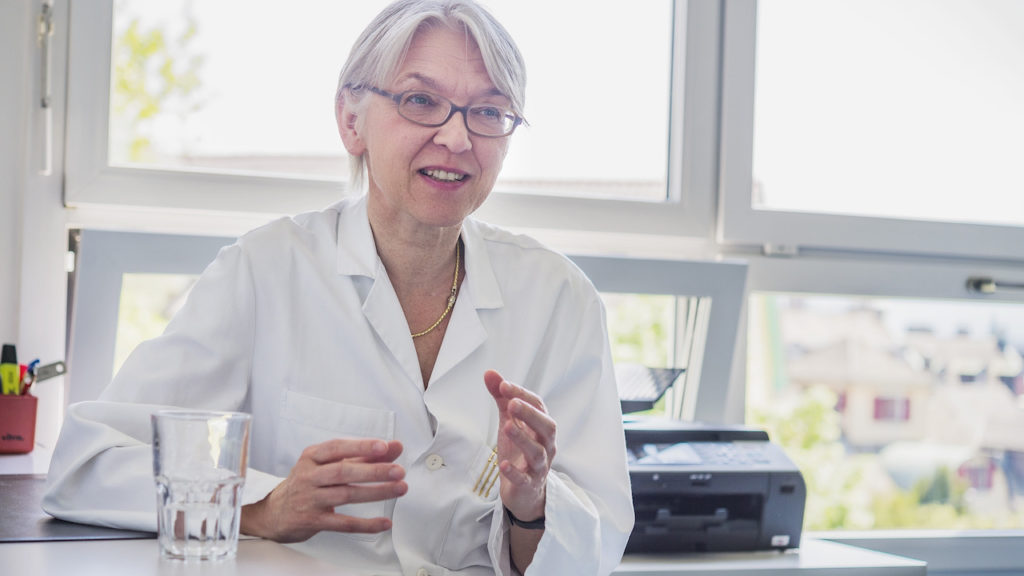
Manchmal muss eine Umarmung möglich sein
Da ist Abgrenzung nötig.
Ja. Und zwar bei mir und bei meinem persönlichen Umfeld, etwa bei meinem Mann. Ich möchte ihn ja nicht dauernd mit meiner Thematik belasten, und trotzdem ist sie spürbar. Ich bin vielleicht traurig, weil etwas nicht gelingt.
Dann gilt es die Ungerechtigkeit des Lebens zu akzeptieren.
Die muss man immer wieder anschauen, das ist etwas ganz Wesentliches.
Wenn jemand nicht Ihre Sprache spricht, einen Migrationshintergrund hat, erschwert das die Zusammenarbeit?
Das ist unterschiedlich. Es gibt kleine Patienten, Patientinnen, die sprachlich nicht kommunizieren können und es gibt Eltern, die unsere Sprache nicht verstehen, sie nicht sprechen können. Es gibt viele Möglichkeiten der Kommunikation, und die kann unheimlich stark sein. Nehmen wir an, Menschen können nicht Ja sagen zum Tod und merken, ich respektiere ihre Haltung, kann damit umgehen und begleite sie trotzdem auf ihrem Weg, dann entsteht vielmals eine beglückende Situation.
Wer in Coronazeiten jemanden trösten will, muss Abstand halten. Wie hat die Seuche Ihre Arbeit beeinflusst?
Die Distanz erlebe ich natürlich ebenfalls. Und es gibt Situationen, da ist Distanzhalten nicht möglich. Bei mir muss niemand hinter einer Maske weinen. Ich behalte meine Maske auf. Und wenn so eine schwere Situation ist, nehme ich Eltern auch mal in Arm. Das muss sein. Damit wehre ich mich nicht gegen die Corona-Schutzmassnahmen, damit bleibe ich Mensch.
Zum Schluss: Was ist Ihr Wunsch an uns, an die Gesellschaft, in Sachen Leben und Sterben?
Es gibt nach wie vor ein gewisses Tabu, was die Unheilbarkeit von Krankheiten anbelangt. Ich wünschte mir diesbezüglich eine grössere Offenheit. Solch schwierige, tragische Ereignisse sollten einen Wert erhalten. Eltern, Familien und gerade die Geschwister, die so einen Verlust erleben mussten, sollten eine Wertschätzung erfahren, die niemals mit einem zusätzlichen Schmerz einhergeht.
Frau Dr. Bergsträsser, danke für das Gespräch am Telefon und für die Fotos, die uns das Kinderspital Zürich zur Verfügung stellt.
Interview: Martin Schuppli, Fotos: Kinderspital Zürich
Das Kinderspital Zürich ist Partner von DeinAdieu. Der Link zum Profil: